Auch Menschen mit Behinderung können ein selbstständiges und weitgehend unabhängiges Leben führen - mit den richtigen Hilfen. Denn eine Behinderung geht in der Regel mit einer Funktionseinschränkung des Körpers einher. Dieser Umstand kann durch den Einsatz von entsprechenden Hilfsmitteln ausgeglichen werden.
Ob es bloß eine Orthese ist, die den unsicheren Fuß stützt, eine Hightech-Prothese, die den fehlenden Arm ersetzt oder ein kompletter E-Rollstuhl mit Bordcomputer - der heutige Markt gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten her. Auch Softwarelösungen wie etwa für die Kommunikation oder zur Erhaltung lebenswichtiger Funktionen gehören mit zu den Hilfsmitteln.
Ein häufiges Problem stellt die Kostenübernahme der dringend benötigten Hilfen dar. Oft werden Zuständigkeiten weggeschoben und Anträge unbegründet abgewiesen. Auch die Unterscheidung zwischen Hilfsmittel und alltäglichem Gebrauchsgegenstand ist nicht immer eindeutig.
Viele Menschen mit Behinderung sind, um ihren Alltag bewältigen zu können, auf Hilfsmittel angewiesen. Diese bezahlt zu bekommen kann allerdings manchmal nervenauftreibend sein. Der Austausch von Erfahrungen mit anderen Betroffenen kann helfen, da so oft entscheidende Tipps weitergegeben werden können. Lesen Sie hier unseren Artikel zum Thema Finanzierung von Hilfsmitteln.
Grundsätzlich regeln die Paragraphen § 33 des SGB V sowie § 31 des SGB IX die Hilfsmittelversorgung. Hier erklären wir Ihnen, was mit dem Begriff Hilfsmittel eigentlich gemeint ist.
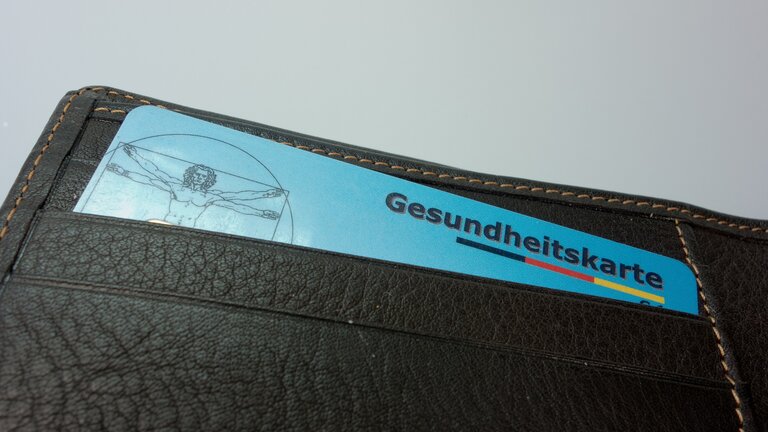
Was ist ein Hilfsmittel?
Was ein Hilfsmittel genau ist, definiert das Neunte Sozialgesetzbuch jedenfalls klar. Im Paragraph 31 ist zu lesen:
Hilfsmittel [...] umfassen die Hilfen, die von den Leistungsempfängern getragen oder mitgeführt oder bei einem Wohnungswechsel mitgenommen werden können und unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles erforderlich sind, um
- einer drohenden Behinderung vorzubeugen,
- den Erfolg einer Heilbehandlung zu sichern oder
- eine Behinderung bei der Befriedigung von Grundbedürfnissen des täglichen Lebens auszugleichen, soweit sie nicht allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens sind.
Was aber ist unter "Grundbedürfnissen des täglichen Lebens" zu verstehen? Diese beinhalten folgende Lebensbereiche, für diese die Hilfen benötigt werden:
- Nahrungsaufnahme und Körperpflege/-hygiene
- Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
- Sehen, Hören, Lesen/Informationsbeschaffung
- Mobilität in Bezug auf Alltagswege/-geschäfte (nicht: Ausflüge!)
- Soziale Integration und Ermöglichung des Schulbesuchs im Rahmen der Schulpflicht (nur bei Kindern und Jugendlichen bis ungefähr 16 Jahre!)
Der Status eines Hilfsmittels ist ebenfalls von seiner Funktion abhängig. Hilfsmittel müssen entweder ausgefallene oder beeinträchtigte Körperfunktionen
- wieder herstellen
- ersetzen
- erleichtern
- ergänzen
oder folgende Funktionen innehaben:
- vor der Folge eines plötzlichen Funktionsausfalls schützen
- Funktionsausfall vermeiden
- Erfolg einer Krankenbehandlung sichern
Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung
Haben Sie noch Fragen zum Thema Hilfsmittel oder möchten Sie sich mit anderen austauschen?


